Lange bevor sich das moderne Finanzwesen entfalten konnte, galt Zinsnahme in der christlichen Welt als eine moralisch verwerfliche Praxis – ein Ausdruck von Gier, von ökonomischer Unnatur. Geld, so der Grundgedanke, darf sich nicht vermehren. Es darf, um mit Aristoteles zu sprechen, nicht „fruchtbar“ sein. Und dennoch war der Wunsch nach Kapital, nach Kredit und Finanzierung ein ständiger Begleiter der Geschichte – selbst in jener Zeit, in der der Zins offiziell als sündhaft galt. Die Geschichte des christlichen Zinsverbots ist damit nicht nur ein Kapitel theologischer Moralphilosophie, sondern auch ein Lehrstück über den Umgang einer Religion mit ökonomischen Realitäten, über Umgehungskünste, Widersprüche – und die allmähliche Auflösung eines moralischen Tabus.
Die Grundlagen dieses Verbots liegen, wie so oft, in der Bibel. Im Alten Testament heißt es: „Wenn du Geld verleihst an einen Armen aus meinem Volk, so sollst du dich nicht wie ein Wucherer verhalten“ (Exodus 22,24). Auch in Levitikus und Deuteronomium wird der Zins als etwas Ungehöriges dargestellt – zumindest im Umgang mit dem „Bruder“, dem Mit-Israeliten. Ursprünglich war das Zinsverbot also sozial motiviert: Es sollte die Schwachen schützen, nicht den Handel unterbinden. Doch im christlichen Mittelalter wurde daraus ein umfassendes wirtschaftliches und moralisches Verdikt: jegliche Zinsnahme, so lautete die kirchliche Auslegung, sei ein Vergehen – unabhängig von der sozialen Lage des Schuldners.
Diese Position wurde von Theologen wie Thomas von Aquin im 13. Jahrhundert mit großer philosophischer Konsequenz verteidigt. Geld, so Aquins Argument, sei ein „consumptibilis“ – ein Gut, das durch seine Nutzung verbraucht werde. Es könne keinen legitimen „Gebrauchswert“ haben, der sich separat in Form von Zinsen bepreisen ließe. Wer also Zinsen verlangte, verkaufte gewissermaßen dasselbe Gut zweimal – ein logischer wie moralischer Irrtum. Überdies war die Zinsnahme für die Kirche ein Ausdruck von Maßlosigkeit, ja von Hochmut: Der Zins wurde als Wucher dämonisiert, als Ausbeutung, als Perversion des natürlichen Wirtschaftsablaufs.
Das kirchliche Zinsverbot wurde über Jahrhunderte durch das kanonische Recht zementiert. Kreditverträge mit Zins wurden für Christen untersagt, Verstöße konnten mit der Exkommunikation geahndet werden. Und doch war die ökonomische Wirklichkeit längst eine andere. Der Bedarf an Kredit war hoch – für den Handel, für die Städte, für die Fürstenhäuser. Also entstanden – wie so oft, wenn Moral auf Bedürfnis trifft – Umgehungsstrategien: Konstrukte wie der „Mora contractus“ oder Wechselgeschäfte mit fiktiven Währungsumrechnungen erlaubten es, Zinsen zu kassieren, ohne sie beim Namen zu nennen. Besonders die florentinischen Bankiers des Spätmittelalters entwickelten hierin eine hohe Kunst – sie betrieben, mit kirchlicher Duldung, ein Geschäft, das man offiziell nicht betreiben durfte.
Eine besondere Rolle in dieser Geschichte kam den Juden zu. Als Nicht-Christen unterlagen sie nicht dem kirchlichen Zinsverbot und wurden so in vielen Regionen Europas zu den de facto Kreditgebern – nicht aus freien Stücken, sondern weil ihnen andere wirtschaftliche Tätigkeiten meist verwehrt waren. Diese Rolle wurde ihnen von der Mehrheitsgesellschaft ebenso zugewiesen wie später vorgeworfen: Das Bild des „jüdischen Wucherers“ wurde zu einem der langlebigsten antisemitischen Stereotype, gespeist aus religiösen, sozialen und wirtschaftlichen Spannungen.
Erst mit der Reformation begannen sich die theologischen Fundamente des Zinsverbots zu lockern. Martin Luther war zwar zunächst ein scharfer Kritiker des Zinses, doch in der Realität seiner Zeit ließ sich der Kredit nicht mehr aus dem Leben verbannen. Den eigentlichen Bruch vollzog Johannes Calvin, der im 16. Jahrhundert argumentierte, dass mäßige Zinsen legitim sein könnten – vor allem, wenn sie dem Gemeinwohl dienten. Calvin war es, der die Tür zur protestantischen Arbeitsethik und zum modernen Verständnis von Kapital als legitimer Quelle des Wachstums aufstieß.
Mit der Aufklärung und der Säkularisierung des Rechtswesens im 18. Jahrhundert verlor das Zinsverbot schließlich seine normative Kraft. In der wirtschaftlichen Theorie wurde Zins nicht mehr als Ausdruck von Sünde, sondern als Preis für Risiko, Verzicht und Zeit verstanden – ein zentrales Element jeder funktionierenden Marktwirtschaft. Was über Jahrhunderte als moralisch verwerflich galt, wurde nun zum Grundpfeiler modernen ökonomischen Denkens.
Und doch ist der Schatten des Zinsverbots nicht vollständig verschwunden. In Teilen der islamischen Welt existieren bis heute Finanzsysteme, die auf der Ablehnung von Zins gründen. Und auch in westlichen Gesellschaften flammt die Debatte immer wieder auf – etwa in der Kritik an der „Finanzialisierung“ der Wirtschaft oder an spekulativen Gewinnformen, die sich von realer Wertschöpfung zu entkoppeln scheinen.
Vielleicht ist das eigentliche Erbe des christlichen Zinsverbots nicht sein Inhalt, sondern die Frage, die es aufwirft: Wie moralisch darf, wie moralisch muss Wirtschaft sein? Eine Frage, die auch heute – angesichts globaler Krisen und wachsender Ungleichheit – nichts von ihrer Brisanz verloren hat.

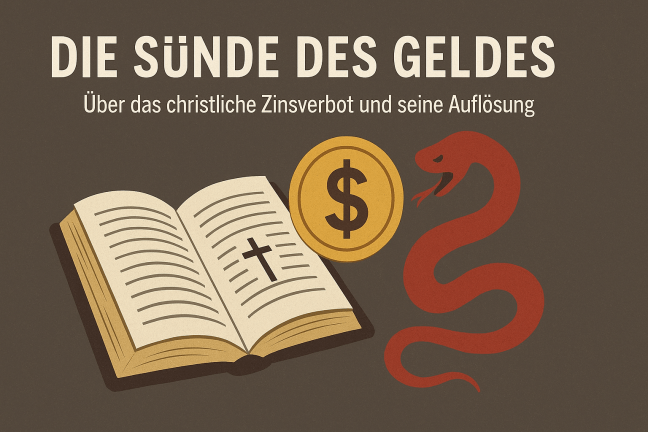
Das Geld ersetzte in der Frühzeit, das gängige Tauschmittel das damals üblich war. Es ist einfacher zu handhaben mit einer Gutschrift, mit einem Geldwert entsprechenden Objekt, oder einem verbrieften Kredit, der auf gegenseitigem Vertrauen basiert. Das Geld, kann nicht, sündigt nicht. Im eigentlichen Sinn, hat Geld nichts mit Sitte und Moral zu tun. Es macht den Verkehr unter Menschen, im geben und nehmen, angenehm. Heutzutage ist es viel einfacher, mit einer Gutschrift, die dem Geldwert entspricht, oder einem verbrieften Kredit, der auf gegenseitigem Vertrauen basiert, zu handeln. Geld selbst ist neutral – es kann nicht sündigen. Im eigentlichen Sinn hat Geld nichts mit Sitte und Moral zu tun. Es erleichtert einfach den Austausch zwischen Menschen, beim Geben und Nehmen.
LikeLike